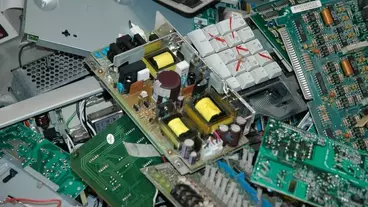Einweg-Kunststoff-Fonds massiv in der Kritik
Wirtschaft kritisiert unnötige Bürokratiekosten durch die Sonderabgabe auf Einweg-Kunststoffprodukte und den denkbar ungünstigen Zeitpunkt der Einführung.

Der Beschluss der Bundesregierung zur Einführung einer Sonderabgabe auf bestimmte Einweg-Kunststoffprodukte stößt bei großen Teilen der der Wirtschaft auf Unverständnis. Danach sollen Hersteller von bestimmten Einweg-Kunststoffprodukten Abgaben in einen staatlichen Fonds einzahlen und so die Reinigungskosten für die entsprechenden Abfälle im öffentlichen Raum übernehmen.
Unverhältnismäßige Bürokratie in der aktuellen Krise vermeiden
Der Vorschlag einer Sonderabgabe komme zur Unzeit, weil die deutsche Wirtschaft vollständig damit ausgelastet sei, den Betrieb trotz explodierender Energiepreise aufrecht zu erhalten und damit für den Erhalt von hunderttausenden von hochbezahlten Arbeitsplätzen zu sorgen. Zudem widerspreche die Entscheidung dem am 29. September 2022 von der Bundesregierung beschlossenen „Belastungsmoratorium“ zur Vermeidung unverhältnismäßiger Bürokratie in der aktuellen Krise und sollte daher zurückgestellt oder zumindest so bürokratiearm wie möglich ausgestaltet werden.
Kritisiert wird nicht nur der Zeitpunkt des Vorschlags, sondern auch dessen Inhalt. Um bei der Umsetzung der EU-Vorgaben unnötige Bürokratiekosten für Unternehmen zu vermeiden, hatten sieben Wirtschaftsverbände bereits im März 2021 einen detaillierten Vorschlag für eine privatwirtschaftliche Umsetzung der erweiterten Herstellerverantwortung vorgelegt.
Gegenvorschlag der Verbände mit wesentlich weniger Bürokratie
„Unser Vorschlag hat gegenüber dem aktuellen Gesetzentwurf den Vorteil, dass er die Unternehmen erheblich weniger belastet, weil die Umsetzung – wie in anderen EU- Mitgliedstaaten auch – in die Hände der betroffenen Wirtschaftsbranchen gelegt wird“, erläutert Antje Gerstein, Geschäftsführerin des Handelsverband Deutschland HDE e. V. Anders als bei der geplanten Sonderabgabe seien im privatwirtschaftlichen Modell keine neuen 30 Planstellen im Umweltbundesamt (UBA) erforderlich und es müssten keine Doppelstrukturen geschaffen werden, weil die Registrierung zum Großteil auf die bereits vorhandenen Daten der Zentrale Stelle Verpackungsregister aufbauen könnte.
Kein Verständnis für Beteiligung des Umweltministeriums
Wenig Verständnis haben die Wirtschaftsvertreter auch dafür, dass Bundesumweltministerium und Umweltbundesamt zentrale Rollen bei der Umsetzung des Gesetzes spielen wollen. „Die EU-Regeln sehen vor, dass die umzulegenden Kosten zwischen den betroffenen Akteuren festgelegt werden, also zwischen Wirtschaft und Kommunen“, erklärt Dr. Martin Engelmann, Hauptgeschäftsführer der IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V. „Nach dem aktuellen Vorschlag sollen die Kosten dagegen allein vom Umweltministerium festgelegt werden. Und das UBA soll festlegen können, wer wofür zahlen soll. Das hat nichts mehr mit dem Prinzip der Herstellerverantwortung zu tun“, kritisiert Engelmann.
Die im Gesetzentwurf vorgesehene so genannte Einweg-Kunststoff-Kommission halten die Verbände für zu schwach, um die Stimme der Wirtschaft wirksam zu vertreten. „Laut Kabinettsbeschluss soll die Kommission lediglich eine beratende Funktion bei der Festsetzung der Abgabensätze haben. Das ist eindeutig zu wenig. Eine 1:1-Umsetzung erfordert eine Kommission mit echten Entscheidungsbefugnissen“, fordert Dr. Andreas Gayk, Geschäftsführer des Markenverband e.V. Auch um die geplante Besetzung der Kommission gibt es Streit. „Umwelt- und Verbraucherverbände sind keine „betroffenen Akteure“ entsprechend den EU-Vorgaben. Stimmberechtigte Mitglieder der Kommission dürfen daher nur Vertreter der betroffenen Wirtschaft und Kommunen in paritätischer Besetzung sein. Nur so kann ein hohes Maß an Akzeptanz bei den Betroffenen geschaffen werden“, so Gayk.
Gewicht als einzig vernünftige Basis zur Kostenermittlung
Unklar ist derzeit noch, wie hoch die Sonderabgabe ausfallen wird. „Es ist – gerade in diesen Zeiten – inakzeptabel, dass aus dem Gesetzentwurf nicht hervorgeht, in welcher Höhe Wirtschaft und Verbraucher belastetet werden sollen“, erklärt Jan Mücke, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse e.V. (BVTE). Die noch ausstehende Ermittlung der umzulegenden Kosten dürfe allein auf Basis des Gewichts erfolgen.
Vorschlägen, zusätzlich auch die Stückzahl und das Volumen mit zu berücksichtigen, erteilt Mücke eine Absage. „Die Ausweitung auf andere Kostenparameter außer Gewicht ist nicht praxisgerecht und würde zu einer massiven Überdeckung der tatsächlichen Kosten der Kommunen führen. Der Kostenanteil muss in einem konkreten Verhältnis zu den Abfallmengen stehen, daher halten wir Beträge, die über den gewichtsmäßigen Anteil von 175 Millionen Euro pro Jahr hinausgehen, für nicht gerechtfertigt“, stellt Mücke fest.
Selbst Hersteller von pfandpflichtige Einweg-Getränkeflaschen sollen zahlen
Kritisiert wird schließlich eine fehlende Ausnahme für pfandpflichtige Einweg-Getränkeflaschen. „In Deutschland sorgt ein effektives Pfandsystem dafür, dass die Gefahr der Vermüllung durch Getränkeflaschen aus Kunststoff stark reduziert wird. Gleichwohl will der Vorschlag auch bepfandete Flaschen mit einer Sonderabgabe belegen“, kritisiert Peter Feller, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie e.V. (BVE). Zwar sei es ein Schritt in die richtige Richtung, dass der Vorschlag unterschiedliche Abgabensätze für pfandpflichtige und nicht-bepfandete Flaschen vorsehe. „Das genügt jedoch nicht: Für Hersteller von bepfandeten Getränkeflaschen bedeuten die Registrierung, Meldung und Abwicklung einen erheblichen bürokratischen Aufwand. Dieser Aufwand steht völlig außer Verhältnis zu der angedachten sehr niedrigen Abgabenhöhe“, kritisiert Feller und fordert dagegen eine Bagatellgrenze, wonach Produkte, die weniger als 1 % des Abfall- und Müll-Aufkommens ausmachen, von den Vorgaben ausgenommen sind.
Verschiedene Einweg-Produkte aus Kunststoff sind seit 3. Juli 2021 komplett verboten. Welche das sind, erfahren Sie in diesem Beitrag der K-ZEITUNG. gk
Passend zu diesem Artikel

WDK: Industrie kommt mit der ausufernden Bürokratie nicht mehr zurecht – und dabei spielt die EU-Gesetzgebung die wesentliche Rolle